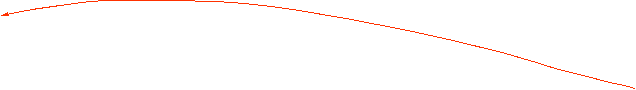Spiegelstühle im Carré für Akteure wie Besucher, die Gleichschaltung von Zuschauer und Performer. Jeder
sieht eine andere
Spiegelung, hört einen anderen akustischen Ausschnitt und gestaltet sich durch die Wahl von
Blickwinkel und Sitzplatz seine eigene Version – eine facettierte Wahrnehmung. Die Performance-Installation widmet sich der
Untersuchung alltäglicher Äußerungen und Gesten, teils abrupter, die nur Sekunden dauern, und stellt sie,
verschärft und fragmentiert, in einen neuen Zusammenhang. Sechs Orte, sechs Anlässe, sechs mögliche Varianten: sie sehen was ich meineSIE SEHEN WAS ICH MEINE SAGEN SIE – oder: SIE SEHEN WAS SIE SAGEN MEINE ICH – oder: ICH MEINE SIE SAGEN WAS SIE SEHEN. Die Paradoxie der drei
gleichberechtigt nebeneinander stehenden Varianten des Titels dieser Arbeit
wirft ihr Licht voraus. Noch vor ihrer leibhaften Begegnung werden Akteure und
Publikum ins Spiel verwickelt, sobald die im Titel nahegelegte Gedankenbewegung
nachvollzogen, der Bedeutungsraum durchmessen wird, der sich durch die
behauptete Gleichwertigkeit solch gegensätzlicher Sicht- und Sprech-, d.h. Denkweisen öffnet.
Was also erwartet mich als Zuschauer? Sage (denke) ich, was ich sehe? Gelingt es
mir, von meinen Erwartungen, d. h. von meiner Voreingenommenheit abzusehen, so
daß Raum entsteht für Wahrnehmungen jenseits der Grenzen meines bisherigen Begriffs- und
Erfahrungshorizonts? Gibt es also eine unmittelbare ästhetische Erfahrung? Oder aber sehe ich, was ich sage (denke)? Bin ich es, der
das Ganze, das Bild, das Ereignis erst erschafft durch eine sinngebende Verknüpfung von Einzelwahrnehmungen, geprägt von meiner Sozialisation, meiner kulturellen Identität, meinem bewußten und unbewußten Erfahrungsschatz? Ist also das, was ich wahrnehme, Projektion und somit auch
eine Rekonstruktion meiner selbst? Und wie verhält es sich schließlich mit dem Verständnis der künstlerischen Absicht? Ist das ästhetische Objekt nun ein Produkt meiner Wahrnehmung, oder gibt es da nicht doch
eine Essenz, eine wie auch immer verschlüsselte Botschaft der Künstler, die es zu dechiffrieren gilt? Sind sie es etwa, die gemeint sind, als
diejenigen, die sagen, was sie sehen – oder sehen, was sie sagen – oder gar behaupten zu sehen, was ich meine?
Die Paradoxie des Titels führt ins Offene. Von welcher Seite aus eine Annäherung auch gesucht wird, immer ist da auch schon ihre Gegenseite, ihre
Infragestellung, ihr Anderes in Sicht. Diese Mehrfachkodierung zersetzt und
durchlöchert alle festen Bezugsgrößen. Was entsteht ist ein Bedeutungsgewebe, licht, beweglich, fließend.
Das Spiel hat also bereits begonnen. Doch noch haben wir den theatralen Raum
nicht betreten. Dessen Koordinaten sind freilich auch in Bewegung geraten, denn
wer dem Weg bis hierher gefolgt ist, sieht sich damit konfrontiert, daß der theatrale Raum sich längst geöffnet hat. Das Spiel vor dem Spiel ist nichts weniger als die Vorwegnahme des
Anfangs - aller Anfänge. Jede der Fragen, die im Titel der Arbeit aufgeworfen werden, zieht weitere
Fragen nach den Bedingungen der eigenen Wahrnehmung, dem Wesen ästhetischer Objekte, der eigenen Erfahrung, ja schließlich der eigenen Geschichte nach sich. Immer weiter wird der Anfang somit
perspektivisch nach vorne verschoben, ins Leben hereingenommen, und immer mehr
werden die Grenzen von Kunst und Leben, von theatralem und Lebensraum
verwischt. Konsequent nennen Angela Dauber und Samuel Rachl ihre Konzeption
daher "weder Theater noch Tanz", sondern "Lebensraum für kleine menschliche Abläufe, Äußerungen, verschärfte Ansätze".
… offener Beginn und offenes Ende …– was also erwartet mich als Zuschauer, wenn alle festen Bezugspunkte sich aufgelöst haben?
Eine Vielzahl stählerner Sitzkonstruktionen (Samuel Rachl) ist im Karree längs der Wände und mit dem Blick auf diese aufgereiht, so daß die Zuschauer mit dem Rücken zur Raummitte sitzen. Vor sich, in die Sitzkonstruktion integriert, einen
beweglichen Spiegel, der je nach Stellung einen Ausschnitt des Geschehens im
sich öffnenden Innenraum hinter ihnen zeigt. Ein jeder bestimmt durch Drehung des
Spiegels selbst, was er sieht. Mal ist es ein Akteur, der erfaßt wird, mal ist es der Spiegel eines anderen, so daß ein vielfach gebrochenes Bild entsteht, oder Spiegelfluchten. Und immer wieder – gewissermaßen im Vorbeischwenken – das eigene Gesicht: Ich also bin es, der bestimmt, was er sieht. Und doch sind
es stets nur Ausschnitte, Details, die allmählich zu einem Ganzen gefügt werden. Das freilich sieht für jeden anders aus, je nachdem, worauf er seine Wahrnehmung fokussiert. So wird
ganz mittelbar das Sehen selbst vergegenwärtigt, als Prozeß aktiver Selektion.
Die Spiegelbilder sind jedoch nur vermittelte. Der Blick ist indirekt, und das
Bild zudem seitenverkehrt. Wer das Geschehen als Ganzes überblicken will, der muß sich umdrehen. Die Wiederherstellung der normalen Betrachterperspektive
geschieht also auf Kosten der vorgegebenen Sitzposition. Und dies erfordert Überwindung. Umso mehr, als es ein Verstoß gegen die vermeintliche Spielregel, den immanenten Systemzwang der stahlgefaßten Sitzordnung ist. So wird das Sehen in einer zweiten Stufe als Akt einer
Befreiung von präformierten Mustern deutlich. Erkenntnis und Normbruch erweisen sich als
zusammengehörig, und das Zusehen wird zu einem Aktivposten des Geschehens.
In dessen Mittelpunkt stehen vier Akteure: Neben Angela Dauber sind dies die
Schauspielerin und Performerin Sonja Breuer, der Autor Jan Schulz sowie der Tänzer und Schauspieler Egmont Körner. Schon vor dem Einlaß hat ihr Part begonnen, dessen Anfang also im Sinne jenes Spiels vor dem Spiel
verborgen bleibt.
Hier beginnt nichts, für niemanden, sondern es sind eine Vielzahl von Handlungs- d. h. Lebenssträngen, die einander für kurze Zeit begegnen. Die Zuschauer, die im nüchternen, antitheatralen Arbeitslicht ihre Plätze aufsuchen und sich mit der ungewohnten und zum Spielen verlockenden Sitz-
und Sehkonstruktion vertraut machen, geraten in den Fluß einer bereits laufenden Aktion. Deren Dynamik speist sich aus dem Neben- und
Ineinander, aus der Koexistenz der autonomen Diskurse, die die vier Akteure
simultan entwickeln. …
Keiner der Beteiligten spielt eine Rolle, befolgt die Anweisungen eines
Regisseurs, ja versetzt sich etwa in eine andere Person. Vielmehr gewinnt die
Arbeit ihre Stärke gerade daraus, daß jeder autonom, aus seinem Selbstverständnis und dem Verständnis seines Metiers heraus, seinen eigenen Diskurs entwickelt. Die Widersprüche, die schon in der Paradoxie des Titels angelegt waren, werden nicht
zugunsten eines übergeordneten Ganzen – in einer Inszenierung, womöglich noch einer Aussage – aufgelöst, sondern existieren nebeneinander, bilden Spannungsfelder, Kraftfelder, die
ins Offene führen.
Ulrich Müller